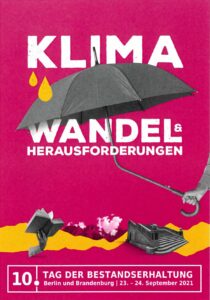“Wie gestalten wir als Bundesarchiv Erinnerungskultur? Wo und wie wollen wir mehr leisten als Unterlagen bereitzustellen, was betrachten wir als unseren gesellschaftlichen Auftrag? Im aktuellen Heft bieten eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen Einblicke in ihre Tätigkeiten, die der Vermittlung und Vertiefung von Archivgut gewidmet sind – darunter Editionen, Ausstellungen, die Arbeit am Gedenkbuch, die Quellenarbeit mit Schülerinnen und Schülern u.a.
Dieser Kontextualisierung sind zwei einleitende Beiträge vorangestellt: Prof. Dr. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, schildert seine Sicht auf Erinnerungskultur als einen wesentlichen Bereich der öffentlichen Auseinandersetzung; Prof. Dr. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, diskutiert, was die Beziehung zwischen Archiv und Erinnerung für unser professionelles Selbstverständnis bedeutet. Anschließend reflektieren wir die Rolle der Archive bei der Herausbildung von Erinnerungskultur durch eine kritische Auseinandersetzung mit der früheren Überlieferungsbildung im Bundesarchiv bzw. durch seine Vorgängerinstitutionen. Zur Abrundung kommen wichtige ausländische Partner zu Wort, die das Verhältnis von Erinnerungskultur und Archiv auf je eigene Weise interpretieren.”
ERINNERUNGSKULTUREN
Archiv und Erinnerung (Michael Hollmann)
Erinnerungskulturen: Ein Gespräch (Meron Mendel)
ÜBERLIEFERUNGSBILDUNG
Das „Erinnerungsarchiv“ des Zentralen Parteiarchivs der SED im ehemaligen Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Simone Walther-von Jena)
Archivare in eigener Sache? – Die ersten Leiter des Militärarchivs und ihre militärische Vergangenheit (Thomas Menzel)
Die Sammlungen der Ostdokumentation im Lastenausgleichsarchiv (Karsten Kühnel)
KONTEXTUALISIERUNG
Historische Bildungsarbeit am außerschulischen Lernort: Ein Vernehmungsprotokoll und seine Auswertung (Peter Gohle / Bernd Kreß)
Die Datenbank „Liste der jüdischen Einwohner im Deutschen Reich 1933-1945 in den Grenzen vom 31.12.1937“ –Quellenauswertung im Bundesarchiv (Annika Estner / Tanja von Fransecky)
Rekonstruktion als Fixpunkt der Erinnerung – Editionen archivischer Quellen (Edgar Büttner)
Ein Archivdokument als Ausstellungsexponat (Gabriele Camphausen)
Themenportale — Neue Formen digitaler Präsentation (Tobias Herrmann / Mirjam Sprau)
PARTNER
United States Holocaust Memorial Museum (Rebecca Boehling)
Pilecki-Institut (Hanna Radziejowska) Babyn Yar Holocaust Memorial Center (Anna Furman)