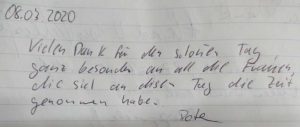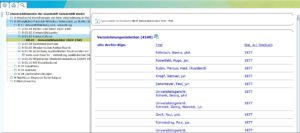Im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv (BBWA) haben wir uns vor allem über die Kommunikation mit mehr als 50 Gästen gefreut, die sich unsere Ausstellung zum Thema „Veränderungen der Korrespondenz der Wirtschaft in einem Jahrhundert“ angesehen haben.
Im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv (BBWA) haben wir uns vor allem über die Kommunikation mit mehr als 50 Gästen gefreut, die sich unsere Ausstellung zum Thema „Veränderungen der Korrespondenz der Wirtschaft in einem Jahrhundert“ angesehen haben.
Die Kommunikationsgeschichte von 1900 bis 1965 haben wir am Beispiel der Schokoladenfabrik Theodor Hildebrand & Sohn aufgezeigt. Dazu wurden u. a. Berliner Adress- und Telefonbücher mit den Einträgen des Unternehmens sowie Briefköpfe mit Fabrikdarstellungen, Sammelbilder, ein Telegramm und den Namenszug „Hildebrand“ (Schriftmarke) in seinen verschiedenen Abwandlungen über die Jahrzehnte gezeigt.
Begeistert war das Publikum auch von der Briefkopfsammlung des Archivs, aus der die schönsten Beispiele zu sehen waren, und die bunte Vielfalt der Werbe- und Reklamemarken. Beides – Briefkopf/Logo und Reklame – sind wohlüberlegte Kommunikationsmittel des Unternehmens.
Ein Lieblingsthema waren die ausgestellten Wurfsendungen des Lieferunternehmens „Call a Pizza“, die das Publikum durch unterschiedliche Farbigkeit und Design überraschten. Die ältesten Exemplare, die sich in in der Werbemittelsammlung des Archivs befinden, stammen aus dem Jahr 1988. Am Anfang mussten die Wurfsendungen noch erklären, wie das so geht mit dem Pizza-Bestellen!
Die Verbindung zwischen den drei Archiven am Eichborndamm wurde mit den vom Wirtschaftsarchiv angebotenen Führungen über das Gelände der ehemaligen Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik (DWM) sichtbar gemacht. Die Tour begann am Landesarchiv und hatte als weitere Stationen das BBWA und das Bundesarchiv (PA).
Weitere Informationen gibt es im Blog des BBWA: Archivspiegel.
Tania Estler-Ziegler